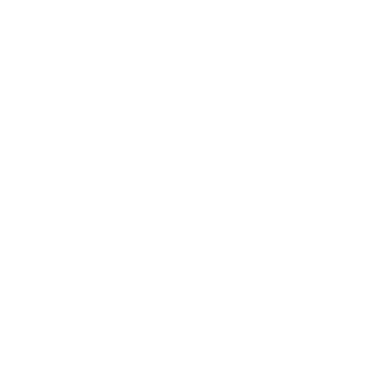Artenschutz ist auch im einfachen Baurecht ernst zunehmen
Oberverwaltungsgericht bestätigt strengen Schutz der Wechselkröte Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) hat die potentielle Tötung eines Teils der letzten Berliner Vorkommen der streng geschützten Wechselkröte auf dem Gelände des sog. „CleanTech Business Park“ (CTB) im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gerichtlich verhindern … Weiter